Ali Dogan
Für den Kreis Minden-Lübbecke
Der Landrat muss zuhören und anpacken.
Ich verstehe die Arbeit eines Landrats so, dass er mit den Menschen in den Austausch tritt. Er hört zu und ist bereit und in der Lage, die Herausforderungen anzugehen. Wenn ich mit den Menschen im Mühlenkreis darüber spreche, welche Themen ihnen politisch wichtig sind, dann höre ich als Antwort häufig Gesundheitsversorgung, KiTa-Plätze, soziale Teilhabe, Bus- und Bahnverkehr oder mangelnder Wohnraum.
Das sind Dinge, um die ich mich als Landrat kümmern werde und die ich verbessern möchte – gemeinsam mit den 11 Kommunen. Mit kreativen Ideen und viel Herzblut werde ich für einen familienfreundlichen, modernen und lebenswerten Kreis arbeiten. Mir liegen dabei alle Orte gleichwertig am Herzen. Aktuell befinden wir uns erneut in einer ernstzunehmenden Situation, leider ist ein Ende noch nicht in Sicht. Gerade in dieser Zeit möchte ich für Sie ansprechbar sein. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit mich zu kontaktieren. Dafür stehen Ihnen verschiedene Kanäle auf dieser Seite zur Verfügung.

WhatsApp-Newsletter
Bleib per WhatsApp auf dem Laufenden.
Anleitung:
- Nummer 0157/34856591 zu deinen Kontakten hinzufügen
- Das Wort „Start“ als WhatsApp-Nachricht an den Kontakt senden
- Ab sofort erhältst du Updates von Ali im WhatsApp-Status
Aktuelles
„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um Interessen von Staaten.“
Dieses Zitat von Egon Bahr beschreibt erschreckend genau, was wir gerade erleben.
Denn wie sonst lässt sich erklären, dass deutsche Außenpolitiker lautstark – und zu Recht – die Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran unterstützen, zu Angriffen auf und der Vertreibung der Kurden in Nordsyrien aber weitgehend schweigen?
Noch schlimmer: In Syrien regiert heute ein Islamist aus dem Umfeld von Al-Qaida. Früher bekannt als Abu Mohammed al-Dscholani, heute im Anzug als Staatsmann. Doch ein neuer Name löscht keine Vergangenheit.
Wir wissen nicht, wie viele Verbrechen er begangen hat.
Wir wissen aber: Er geht brutal gegen die demokratischen Kurden in Nordsyrien vor.
Und genau deshalb frage ich:
Ist das wirklich ein Gesprächspartner für Berlin – ausgerechnet jetzt?
Wer ihn hofiert, legitimiert Islamismus.
Und legitimiert Gewalt gegen Minderheiten.
Warum wiederholen wir diesen Fehler immer wieder?
Was gewinnen wir, wenn ein Unrechtsregime durch ein anderes ersetzt wird?
Unsere Geschichte zeigt: Solche Despoten verstehen nur eine Sprache – Stärke.
Fallen die Kurden in Nordsyrien, fällt eines der letzten Bollwerke gegen islamistische Herrschaft.
So verspielen wir unsere Glaubwürdigkeit.
Ich verstehe die Logik der Interessen.
Aber ich weigere mich, sie hinzunehmen.
Die Kurden in Nordsyrien verdienen unsere Solidarität.
Aus Verantwortung.
Und aus dem Mut, endlich für unsere eigenen Werte einzustehen.
Die Frage ist nicht, ob wir uns Solidarität leisten können –
sondern ob wir es uns leisten können, darauf zu verzichten.

„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um Interessen von Staaten.“
Dieses Zitat von Egon Bahr beschreibt erschreckend genau, was wir gerade erleben.
Denn wie sonst lässt sich erklären, dass deutsche Außenpolitiker lautstark – und zu Recht – die Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran unterstützen, zu Angriffen auf und der Vertreibung der Kurden in Nordsyrien aber weitgehend schweigen?
Noch schlimmer: In Syrien regiert heute ein Islamist aus dem Umfeld von Al-Qaida. Früher bekannt als Abu Mohammed al-Dscholani, heute im Anzug als Staatsmann. Doch ein neuer Name löscht keine Vergangenheit.
Wir wissen nicht, wie viele Verbrechen er begangen hat.
Wir wissen aber: Er geht brutal gegen die demokratischen Kurden in Nordsyrien vor.
Und genau deshalb frage ich:
Ist das wirklich ein Gesprächspartner für Berlin – ausgerechnet jetzt?
Wer ihn hofiert, legitimiert Islamismus.
Und legitimiert Gewalt gegen Minderheiten.
Warum wiederholen wir diesen Fehler immer wieder?
Was gewinnen wir, wenn ein Unrechtsregime durch ein anderes ersetzt wird?
Unsere Geschichte zeigt: Solche Despoten verstehen nur eine Sprache – Stärke.
Fallen die Kurden in Nordsyrien, fällt eines der letzten Bollwerke gegen islamistische Herrschaft.
So verspielen wir unsere Glaubwürdigkeit.
Ich verstehe die Logik der Interessen.
Aber ich weigere mich, sie hinzunehmen.
Die Kurden in Nordsyrien verdienen unsere Solidarität.
Aus Verantwortung.
Und aus dem Mut, endlich für unsere eigenen Werte einzustehen.
Die Frage ist nicht, ob wir uns Solidarität leisten können –
sondern ob wir es uns leisten können, darauf zu verzichten.
Schweigen ist keine Neutralität.
Schweigen ist Parteinahme.
Im Iran kämpfen mutige Frauen und Männer für Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenrechte.
In Syrien werden kurdische Menschen von islamistischen Milizen ermordet – und die Welt schaut zu.
Ich sage klar:
❌ Kein Platz für islamistische Regime
❌ Kein Platz für Scharia-Staaten
❌ Kein Platz für Extremismus – egal wo
Hier in Deutschland sagen wir völlig zu Recht:
Kein Platz für islamistische Gefährder.
Kein Platz für diese barbarische Ideologie.
Aber wenn wir zulassen,
dass genau solche Regime anderswo an die Macht kommen –
wie in Syrien.
Wie zuvor in Afghanistan –
dann haben wir längst verloren.
Denn der Hass auf unsere Art zu leben
wird genau dort gezüchtet.
Genau dort radikalisiert.
Genau dort bewaffnet.
Meine Solidarität gilt den Menschen, die für unsere Werte kämpfen.
Im Iran.
In Nordsyrien.
Überall.
Wir dürfen nicht wegsehen.
Wir dürfen nicht relativieren.
Wir dürfen nicht schweigen.
✊ Freiheit.
✊ Vielfalt.
✊ Menschenrechte.
#Iran #Syrien #Kurdistan #Menschenrechte #Freiheit

Schweigen ist keine Neutralität.
Schweigen ist Parteinahme.
Im Iran kämpfen mutige Frauen und Männer für Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenrechte.
In Syrien werden kurdische Menschen von islamistischen Milizen ermordet – und die Welt schaut zu.
Ich sage klar:
❌ Kein Platz für islamistische Regime
❌ Kein Platz für Scharia-Staaten
❌ Kein Platz für Extremismus – egal wo
Hier in Deutschland sagen wir völlig zu Recht:
Kein Platz für islamistische Gefährder.
Kein Platz für diese barbarische Ideologie.
Aber wenn wir zulassen,
dass genau solche Regime anderswo an die Macht kommen –
wie in Syrien.
Wie zuvor in Afghanistan –
dann haben wir längst verloren.
Denn der Hass auf unsere Art zu leben
wird genau dort gezüchtet.
Genau dort radikalisiert.
Genau dort bewaffnet.
Meine Solidarität gilt den Menschen, die für unsere Werte kämpfen.
Im Iran.
In Nordsyrien.
Überall.
Wir dürfen nicht wegsehen.
Wir dürfen nicht relativieren.
Wir dürfen nicht schweigen.
✊ Freiheit.
✊ Vielfalt.
✊ Menschenrechte.
#Iran #Syrien #Kurdistan #Menschenrechte #Freiheit
Heute Morgen habe ich das Büro erneut gegen einen Kittel getauscht.
Praktikums-Tag. 🩺
Dieses Mal war ich im Krankenhaus Bad Oeynhausen und durfte einen Tag in der Endoskopie mitlaufen.
Wie viele von euch wissen, absolviere ich regelmäßig Praktika in den Bereichen, für die ich politisch zuständig bin.
Vom Bauernhof über Polizei, Zentrale Notaufnahme und Intensivstation bis hin zur Poststelle, zum Jobcenter, zu Straßenwärtern oder in den Kindergarten – die Bandbreite ist groß.
Und wo ich noch nicht war, komme ich bestimmt noch hin (meldet euch gern 😉).
Warum ich das mache?
Ganz einfach: An einem einzigen Tag lernt man oft mehr als durch wochenlanges Aktenstudium. Vor allem die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind enorm wertvoll. Und ich sehe, wie Arbeit ganz praktisch aussieht.
Heute z. B. bei einer Magen- und Darmspiegelung sowie einer Bronchoskopie.
Im Krankenhaus Bad Oeynhausen bin ich einem hochengagierten Team begegnet, das seit Jahren großartige Arbeit für die Patientinnen und Patienten leistet. Davon konnte ich mich heute persönlich überzeugen.
Genau deshalb wollen wir in den Standort Bad Oeynhausen investieren:
Geplant ist ein Neu- bzw. Anbau des Krankenhauses an die Auguste-Victoria-Klinik mit einem Volumen von rund 120 Mio. Euro. Der Baubeschluss soll – so hoffen wir – im Spätsommer dieses Jahres gefasst werden.
Mein herzlicher Dank gilt Dr. Engelhard, Dr. Turkiewicz und den gesamten Teams für die hervorragende Betreuung und die offenen Einblicke heute.
Solche Tage zeigen mir immer wieder, wie wichtig gute Rahmenbedingungen für engagierte Menschen im Gesundheitswesen sind.

Heute Morgen habe ich das Büro erneut gegen einen Kittel getauscht.
Praktikums-Tag. 🩺
Dieses Mal war ich im Krankenhaus Bad Oeynhausen und durfte einen Tag in der Endoskopie mitlaufen.
Wie viele von euch wissen, absolviere ich regelmäßig Praktika in den Bereichen, für die ich politisch zuständig bin.
Vom Bauernhof über Polizei, Zentrale Notaufnahme und Intensivstation bis hin zur Poststelle, zum Jobcenter, zu Straßenwärtern oder in den Kindergarten – die Bandbreite ist groß.
Und wo ich noch nicht war, komme ich bestimmt noch hin (meldet euch gern 😉).
Warum ich das mache?
Ganz einfach: An einem einzigen Tag lernt man oft mehr als durch wochenlanges Aktenstudium. Vor allem die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind enorm wertvoll. Und ich sehe, wie Arbeit ganz praktisch aussieht.
Heute z. B. bei einer Magen- und Darmspiegelung sowie einer Bronchoskopie.
Im Krankenhaus Bad Oeynhausen bin ich einem hochengagierten Team begegnet, das seit Jahren großartige Arbeit für die Patientinnen und Patienten leistet. Davon konnte ich mich heute persönlich überzeugen.
Genau deshalb wollen wir in den Standort Bad Oeynhausen investieren:
Geplant ist ein Neu- bzw. Anbau des Krankenhauses an die Auguste-Victoria-Klinik mit einem Volumen von rund 120 Mio. Euro. Der Baubeschluss soll – so hoffen wir – im Spätsommer dieses Jahres gefasst werden.
Mein herzlicher Dank gilt Dr. Engelhard, Dr. Turkiewicz und den gesamten Teams für die hervorragende Betreuung und die offenen Einblicke heute.
Solche Tage zeigen mir immer wieder, wie wichtig gute Rahmenbedingungen für engagierte Menschen im Gesundheitswesen sind.
Über mich.
Ich bin ein Kind Ostwestfalens, 1982 in Herford geboren, aufgewachsen in Enger, Spenge und Bünde. Als ich 30 wurde, zog es mich beruflich in den Rhein-Sieg-Kreis. Mit meiner Frau Sevil (verheiratet seit 2010) und unseren beiden Kindern Levan (geboren 2013) und Mavi (geboren 2018) leben wir in Sankt Augustin. Ich bin ein Familienmensch. Die Zeit mit meiner Frau, unseren Kindern und unserem Familienhund Toto ist für mich das Wertvollste.
Nachdem ich 7 Jahre im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW gearbeitet hatte, wurde ich 2017 einstimmig vom Rat der Stadt Sankt Augustin zum Beigeordneten gewählt. 2020 bin ich zum Ersten Beigeordneten bestellt worden.
In meiner Freizeit steht meine Familie im Mittelpunkt. Daneben versuche ich regelmäßig Mittel- und Langstreckenläufe zu absolvieren. Ein weiteres Hobby von mir ist das Kino, da dürfen es gerne auch mal richtige „Hollywood-Blockbuster“ sein.
An Wochenenden stehe ich zudem gerne am Herd und bereite regelmäßig den Sonntags-Brunch vor.

Mein politisches Engagement
Ich habe viel Erfahrung im kommunalpolitischen Ehrenamt: Ich war für die SPD sowohl Mitglied des Kreistages von Herford als auch des Rates der Stadt Königswinter.
Seit 2012 bin ich Mitglied der AWO. Zur selben Zeit wurde ich zum Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der NRWSPD gewählt. Dieses Amt habe ich bis 2016 bekleidet und war damit ständiger Teilnehmer der Vorstandssitzungen der NRWSPD. Somit kenne ich auch die Landespolitik sehr gut. In all diesen Jahren habe ich eins gelernt: Das kommunale Ehrenamt, egal ob parteipolitisch oder in anderen Vereinen, ist mehr als der Kitt unserer Gesellschaft – es gehört zum Fundament! Daher bin ich auch in zahlreichen Fördervereinen (Musikschule, Kindergarten, Grundschule, Sportverein, Karnevalsverein) Mitglied und unterstütze dieses ehrenamtliche Engagement, wie und wo ich kann.
Mein berufliches Engagement
Mein Lebensweg.
Erfahren Sie hier mehr über die wichtigsten Stationen in meinem Leben.
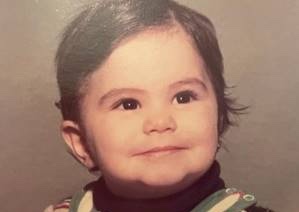
1982
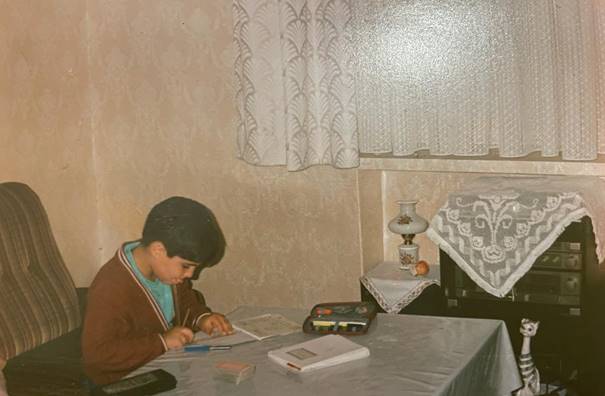
1988-2001
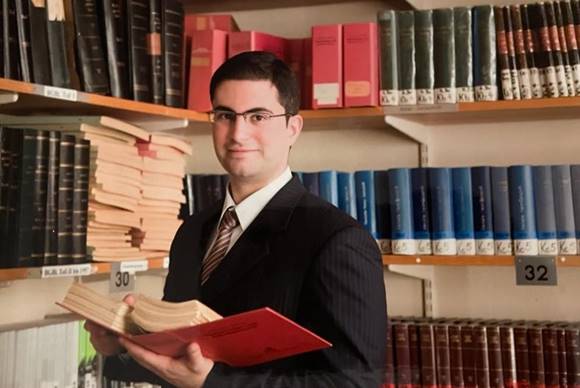
2001-2009
Direkt nach dem Abitur habe ich Jura an der Uni Bielefeld studiert und habe mein Referendariat an den Landgerichten Detmold und Bielefeld erfolgreich absolviert.

2006

2010

2010-2016
Ich habe 6 Jahre im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW gearbeitet und war dort u. a. tätig als Persönlicher Referent der Staatssekretärin und als Stv. Referatsleiter in der Arbeitsmarktabteilung. Meine Kontakte zur Landesebene pflege ich weiterhin und sie sind mir wichtig.

2012

2017
Im Jahre 2017 wurde ich zum Beigeordneten der Stadt Sankt Augustin gewählt. Als Sozial- und Jugenddezernent war es mir seit jeher wichtig, mich für soziale Teilhabe aller Altersgruppen einzusetzen. Insbesondere die (frühkindliche) Bildung liegt mir sehr am Herzen.

2020
Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat mich 2020 zum Ersten Beigeordneten bestellt. Damit bin ich der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Während der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges habe ich als Leiter des Krisenstabes dafür gesorgt, dass unsere Stadt sicher durch die herausforderungsvolle Zeit kommen konnte.
